Der Rekrut
Nun sorgte aber der Staat selbst dafür, daß die Überlieferung
nicht allzu starr wurde und der junge Mensch auch über die Grenzen
seines Heimatorts hinausschauen lernte. Er zog, was tauglich war, auf
zwei bis drei Jahre zur militärischen Ausbildung ein. Diese Jahre
warfen ihre Schatten voraus. Ehe man in ihre harte Zucht genommen wurde,
wollte man sich noch einmal austoben. Füllte man sich doch mit
seinen zwanzig Jahren voll strotzender Jugendkraft und voll Drang nach
Lebensfreude. Noch war man ungebunden, hatte nicht für Weib und
Kind zu sorgen, und da nun der Vater Staat einen als Vollbürger
anerkannte, durften auch die Sitten einen nicht mehr so Stark unter
der Fuchtel halten und mußten ein Auge zudrücken können,
wenn der Sohn da und dort einmal über die Stränge Schlug.
Freilich nicht alle Väter waren Solchen oder ähnlichen Gedankengängen
so ohne weiteres zugänglich. Aber nach einiger Bearbeitung gaben
doch die meisten ihrem Sohne die Erlaubnis zum Eintritt in seinen "Jahrgang".
Die angehenden Rekruten schlossen sich nämlich in dem Winter,
ehe sie "spielen" mußten, zu einer Kameradschaft eigener Prägung
zusammen. Man nahm Singstunden bei einem Lehrer, in denen eine Unzahl
Volks-, vor altem einige kräftige Soldatenlieder eingeübt
wurden. Wen man diese Ausbildung hinter Sich hatte, konnte man auch
der Öffentlichkeit unter die Augen treten. In den Winternächten
zogen nun die Rekruten unter Gesang im Dorf umher. Sonntag nachmittags
ging man auswärts und erfreute die Nachbarorte mit seiner Gesangskunst.
Der Gesang war freilich nicht immer ein Gesang zu nennen. Immerhin
wurde dem Hörer einiges nachdrücklich ins Gedächtnis
geprägt, so der endlose Kehrreim: "Dann schickt uns König
Wilhelm wieder ohne, ohne Geld nach Haus", und das ganz blutrünstige: "Da
liegt ein Fuß, ein Arm, ach daß es Gott erbarm', man sieht
fast keinen Boden vor Sterbenden und Toten." Nicht alle Nachbarorte
vertrugen sich miteinander. Untertürkheimer und Wangener Rekruten
besonders lagen in ständiger Fehde. Den Abschluß des Sonntags
bildete nach diesen Märschen regelmäßig eine ausgedehnte
Sitzung in einer Wirtschaft. So ging es den Winter über bis zum
Frühjahr.
Da war Musterung und dann "Ziehung". Denn angenommen, es wurden von
mehreren Gemeinden zusammen 300 Rekruten ausgemustert, so brauchte
man tatsächlich vielleicht kaum 200. Der Rest mußte, obwohl
tauglich, ausgeschieden werden. Diese Ausmerzung geschah durchs Los,
deshalb sprach man von "Ziehung" und "Spielen". Wer eine hohe Nummer,
in unserem angenommenen Fall also eine Nummer zwischen 200 und 300
zog, hatte sich "frei gespielt". So fuhren nun die Rekruten im Frühjahr
auf einem Leiterwagen, der mit Maien geschmückt war, voll Stolz
gen Cannstatt zur Musterung. Auch dabei stachen die verschiedenen Ortschaften
aufeinander, jede wollte den schönsten Wagen haben. Schon die
vorgeschriebene gründliche Reinigung des Körpers hatte in
den ländlichen Verhältnissen Alt=Untertürkheims, wo
es keine Badegelegenheit gab, allerhand Schwierigkeiten bereitet, und
bei der Musterung selbst ereignete sich in der allgemeinen Aufregung
manch ergötzliche Szene, die noch lange willkommenen Unterhaltungsstoff
auf Kosten der Beteiligten bot. Wenn jetzt die Entscheidung gefallen
war, waren die Freigekommenen gehalten, den andern die bunten Rekrutenbänder
zu bezahlen, mit denen man die Hüte schmückte. Wer tauglich
befunden wurde, trug lange und breite Bänder um den Hut geschlungen,
die noch weit über den Rücken herunterfielen; die Untauglichen
durften nur kurze, schmale Bänder tragen. Auf der stolzgeschwellten
Braust trug jeder ein Täfelchen mit der Bezeichnung der Waffengattung,
für die er ausersehen war. Der Tag, der so entscheidend in das
Leben der jungen Leute eingriff, wurde entsprechend gefeiert, zunächst
in der Oberamtstadt, dann aber auch im Heimatort. Wie so oft bei allerhand
Streichen, die sie verübt, so pochte die Jugend besonders an diesem
Tag auf das Wort: "Rekrutebluof ischt koe Riehrmilch."
Nach einiger Zeit fand dann die "Ziehung" statt, von der oben gesprochen
wurde. Zum sonstigen Schmuck hinzu konnte man nun auch noch die gezogene
Nummer am Hute befestigen. Damit war die Spannung, unter der man gelebt
hatte, endgültig gelöst, und man sah klarer in die Zukunft.
In den sechziger Jahren gab es allerdings auch noch die sogenannten "Einsteher".
Wer das nötige Geld dazu aufbringen konnte und wollte, hatte die
Möglichkeit, sich gewissermaßen loszukaufen. Er bestimmte
gegen Zahlung von 300-400 Gulden einen andern, der schon gedient hatte
und eben entlassen wurde, für ihn einzustehen und an seiner Stelle
noch einmal zwei bis drei Jahre abzudienen.
Das weitere Schicksal der bunten Rekrutenbänder zeigt, wie wichtig
diese entscheidungsvollen Tage genommen wurden. Der Rekrut Schenkte
die Bänder seiner "Bekanntschaft", wenn er eine hatte, und die
hielt sie in hohen Ehren, sie zierte damit ihre Kunkel und forderte
dadurch den Neid mancher weniger glücklichen Altersgenossin heraus.
Nach der Musterung flatterte der Jahrgang keineswegs auseinander. Wohl
blieb in den arbeitsreichen Sommermonaten wenig Gelegenheit, die Kameradschaft
zu pflegen. Dafür brachte der Herbst die Krönung des Kameradschaftslebens:
die Kirbe. Tonangebend auf der Kirbe waren die "Kirbebuebe", eben der
Rekrutenjahrgang. Sie verteilten sich auf die drei Hauptwirtschaften,
den "Hirsch", die "Kronen, den "Löwen". Das ganze Jahr über
hatte man auf diese zwei Tage gespart, die eigentliche Kirbe, die auf
den Donnerstag nach Kreuzerhöhung festgelegt ist und auf die "Nôchkirbe",
den Sonntag nach diesem Donnerstag. Bis zu zehn Gulden, eine gewaltige
Summe für die damalige Zeit gedachte mancher springen zu lassen.
Zunächst galt es, die Wirtschaft, an der man den "Trauben" heraushängte,
festlich zu schmücken. Zu diesem Zweck fuhr man zwei Tage vor
der Kirchweih mit den Pferden und dem Leiterwagen des Wirts etwa in
den Eßlinger Stadtwald, wo man sich die Erlaubnis ausgewirkt
hatte, einige Maien (Birkenbäume) zu schlagen. Ehe die Rekruten
in den kühlen Morgen hinausfuhren, hatte der Wirt - so verlangte
es der Brauch - ihnen einen Trunk guten Weins gereicht. Dem Förster,
der die Aufsucht hatte, brachte man ein Körbchen Trauben mit,
in der berechtigten Hoffnung, daß er es beim Messen des Holzes
- man kaufte die Birken dem Längenmaß nach - nicht allzu
genau nehmen werde. Nach der Rückkehr wurden die Maien in festesfroher
Vorfreude an dem Gasthaus aufgestellt.
Auch der große Trauben der vor dem Gasthaus
aufgehängt werden sollte, mußte gerichtet werden. Es erforderte
Geduld und Geschicklichkeit, ihm die richtige Form zu geben, Denn er
wurde nachher, wenn er hing, von den Alten fachkundig begutachtet.
Die Trauben lieferten die Kirbebuben. Jeder wollte natürlich die
schönsten bringen. War der Jahrgang gut und der Reifegrad schon
weit vorgeschritten, was selten der Fall war, denn wir befinden uns
erst Mitte September, dann wurde an den schönsten Trollingern
in des Vaters Weinberg der Stiel umgezwirbelt, damit sie rascher schwarz
wurden. Auch bei diesem Geschäft des Traubenrichtens mußte
der Wirt auf seine Kosten fleißig einschenken.
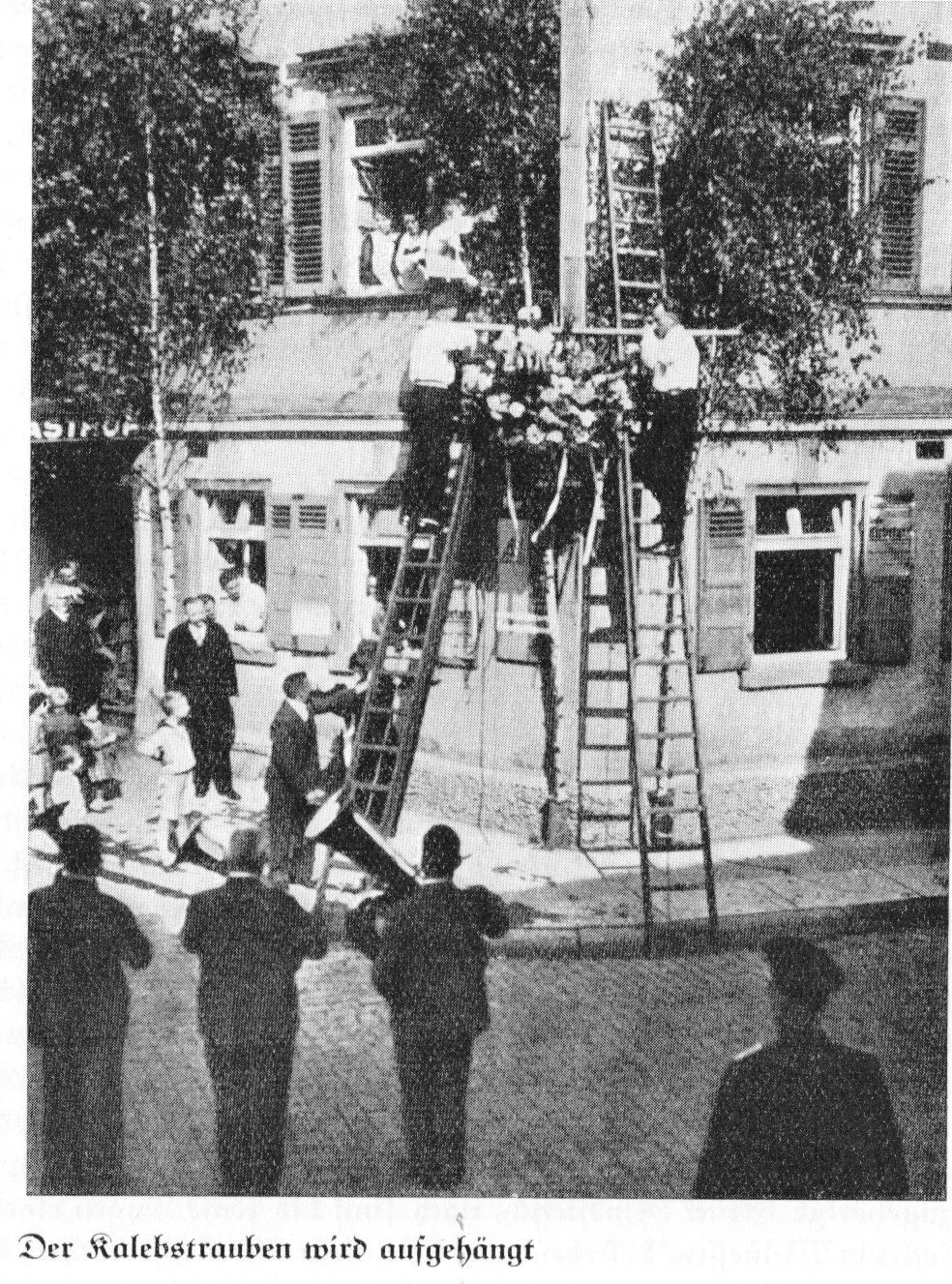 Nun ist der große Tag angebrochen. Schon am
frühen Morgen hatten Sich Musikanten eingefunden. Es waren jedes
Jahr dieselben. Sie stammten von den Fildern, von Häfner=Neuhausen.
An diesem Tag mußten sie sich von den Rekruten manches gefallen
lassen. Diese nahmen für sich das Recht in Anspruch, mit ihnen
allerhand Narrenpossen zu treiben, ließen Sich aber andererseits,
wenn es ans Zahlen ging, auch nicht lumpen. Zunächst zogen die
Musikanten im Ort umher und verbreiteten allenthalben festliche Stimmung.
Vor allem tat sich dabei das Bombardon mit seinen Baßtönen
hervor. Bald entwickelte Sich auch das vom Märzmarkt her bekannte
Markttreiben. Diesmal Sind es Fässer, Leitern, Butten und sonstiges
Küblergeschirr, die dem Markt das Gepräge geben. Diese ernsthaftere
Seite der Kirbe kümmerte aber die Rekruten nicht viel. Ihre Zeit
kam erst nach Mittag, wenn der große Trauben aufgehängt
wurde. Schon hatte sich auch viel neugieriges Volk eingefunden, um
dem feierlichen Akt beizuwohnen. Im blütenweißen Hemd, das
schwarzweißrote Band über der Weste, ohne Kittel, so tragen
die zwei kräftigsten und gewandesten Kirbebuben den Riefentrauben
heraus, der ein ordentliches Gewicht hat. Unter Viel juchzen, das man
das letzte Jahr über ausgiebig geübt hat. Steigen sie mit
dem Trauben die Leitern empor und bringen das Kunstwerk fertig, ihn
oben am Haken einzuhängen. Ein Kamerad steigt ihnen nach und reicht
ihnen ein Glas Wein, das mit weiteren kräftigen Juchzern geleert
wird. Zur Freude der Kinder wird auch der kleine Trauben aufgehängt.
Er besteht bloß aus drei verschiedenfarbigen Trauben, einem weißen,
einem roten, einem blauen, um ihn herum aber hängt an einem Reif
in kleinen Nachbildungen das ganze Geschirr, das der Weingärtner
zu seinem Beruf braucht. Weil das alles so putzig aussieht, freut es
die Kinder. Um die Leitern herum ist der Platz freigehalten worden,
und da drehen sich die Paare schon im Tanz, bis die zwei Kirbebuben
die Leitern herunterkommen. Die Mädchen tragen die gleichen farbigen
Bänder wie ihre Burschen, nur in schmälerer Ausführung.
Schon hat sich unter der Masse der Zuschauer auch eine Menge Städter
eingefunden, und nun geht der Rummel los, den man Kirbeleben nennt.
Nicht laut und ausgelassen genug kann es ja zugehen. Es ist viel überschüssige
Kraft vorhanden, die sich austoben will. Die Nachkirbe bringt dasselbe
Schauspiel noch einmal, dann beginnt wieder der graue Alltag.
Nun ist der große Tag angebrochen. Schon am
frühen Morgen hatten Sich Musikanten eingefunden. Es waren jedes
Jahr dieselben. Sie stammten von den Fildern, von Häfner=Neuhausen.
An diesem Tag mußten sie sich von den Rekruten manches gefallen
lassen. Diese nahmen für sich das Recht in Anspruch, mit ihnen
allerhand Narrenpossen zu treiben, ließen Sich aber andererseits,
wenn es ans Zahlen ging, auch nicht lumpen. Zunächst zogen die
Musikanten im Ort umher und verbreiteten allenthalben festliche Stimmung.
Vor allem tat sich dabei das Bombardon mit seinen Baßtönen
hervor. Bald entwickelte Sich auch das vom Märzmarkt her bekannte
Markttreiben. Diesmal Sind es Fässer, Leitern, Butten und sonstiges
Küblergeschirr, die dem Markt das Gepräge geben. Diese ernsthaftere
Seite der Kirbe kümmerte aber die Rekruten nicht viel. Ihre Zeit
kam erst nach Mittag, wenn der große Trauben aufgehängt
wurde. Schon hatte sich auch viel neugieriges Volk eingefunden, um
dem feierlichen Akt beizuwohnen. Im blütenweißen Hemd, das
schwarzweißrote Band über der Weste, ohne Kittel, so tragen
die zwei kräftigsten und gewandesten Kirbebuben den Riefentrauben
heraus, der ein ordentliches Gewicht hat. Unter Viel juchzen, das man
das letzte Jahr über ausgiebig geübt hat. Steigen sie mit
dem Trauben die Leitern empor und bringen das Kunstwerk fertig, ihn
oben am Haken einzuhängen. Ein Kamerad steigt ihnen nach und reicht
ihnen ein Glas Wein, das mit weiteren kräftigen Juchzern geleert
wird. Zur Freude der Kinder wird auch der kleine Trauben aufgehängt.
Er besteht bloß aus drei verschiedenfarbigen Trauben, einem weißen,
einem roten, einem blauen, um ihn herum aber hängt an einem Reif
in kleinen Nachbildungen das ganze Geschirr, das der Weingärtner
zu seinem Beruf braucht. Weil das alles so putzig aussieht, freut es
die Kinder. Um die Leitern herum ist der Platz freigehalten worden,
und da drehen sich die Paare schon im Tanz, bis die zwei Kirbebuben
die Leitern herunterkommen. Die Mädchen tragen die gleichen farbigen
Bänder wie ihre Burschen, nur in schmälerer Ausführung.
Schon hat sich unter der Masse der Zuschauer auch eine Menge Städter
eingefunden, und nun geht der Rummel los, den man Kirbeleben nennt.
Nicht laut und ausgelassen genug kann es ja zugehen. Es ist viel überschüssige
Kraft vorhanden, die sich austoben will. Die Nachkirbe bringt dasselbe
Schauspiel noch einmal, dann beginnt wieder der graue Alltag.
Und ein Oktobermorgen setzt den Schlußpunkt hinter das lustige
Rekrutenjahr. Schon lange vor Morgengrauen donnern vom Berg herunter
die Karabiner der zurückbleibenden Kameraden, in aller Frühe
entführt der Zug die Rekruten in die Garnisonstadt: das Spiel
ist aus, der Ernst beginnt.