Der Jahreslauf im Leben des Dorfkindes
Wenn der Frühling kommt, beginnt für die
Alten die strengste Arbeit, für die Kinder die des Spielens. Man
kann wieder auf die Gasse. Allerdings die Mutter hat auch für
diese allerhand Aufgaben bereit. Der kleine Bub muß, wenn er
von der Schule daheim ist, sein noch kleineres Schwesterlein wiegen.
Doch der junge Mann stellt die Technik in den Dienst seines Freiheitsdrangs.
Eine Schnur reicht von der Gasse hinauf in die Stube, wo die Wiege
ihren Platz hat, und gibt dem jungen die Möglichkeit, bei den
Kameraden zu sein. Daß dabei die Wiege manchmal umkippt bereitet
dem Bruder weniger Schmerzen als dem Schwesterlein. Rasch schiebt er
ihm den "Schlotzer" in den Mund, und die Kleine beruhigt sich wieder.
Oder die Kinder müssen dem Vater dann und wann "das Essen tragen",
wenn er über Mittag im Feld oder im Weinberg bleibt. Mancher
Bube muß schon im ersten Morgengrauen vor der Schule, die um
Sieben Uhr beginnt, Milch nach Stuttgart tragen. Aber es gibt für
die Kinder trotz all dieser kleinen Pflichten dazwischenhinein immer
wieder freie Zeit, da man dem eigenen Vergnügen nachgehen kann.
Kaum hat der Märzenwind die Straßen halbwegs getrocknet,
holen die Buben alte Faßreifen hervor und jagen mit ihnen durch
den Ort. Das erste Spiel der Mädchen ist "Seilhopfes". Darin liegt
ein tiefer Sinn: das verhockte Blut verlangt nach Bewegung. Dann
wird der "Tänzer" hervorgeholt, an anderen Orten unter dem Namen "Topf" oder
Kreisel bekannt. Die "Treibschnur" hilft dazu, daß man allenthalben
durch den Ort die Peitschen knallen hört. Noch kann auf der Straße
der Jugend nicht allzu viel passieren, denn sie wird durch keine Autos
unsicher gemacht. Und bei den Hochrädern (Velozipede), die damals
auftauchten, war bei einem Zusammenstoss der Fahrer weit mehr gefährdet
als der Fußgänger.
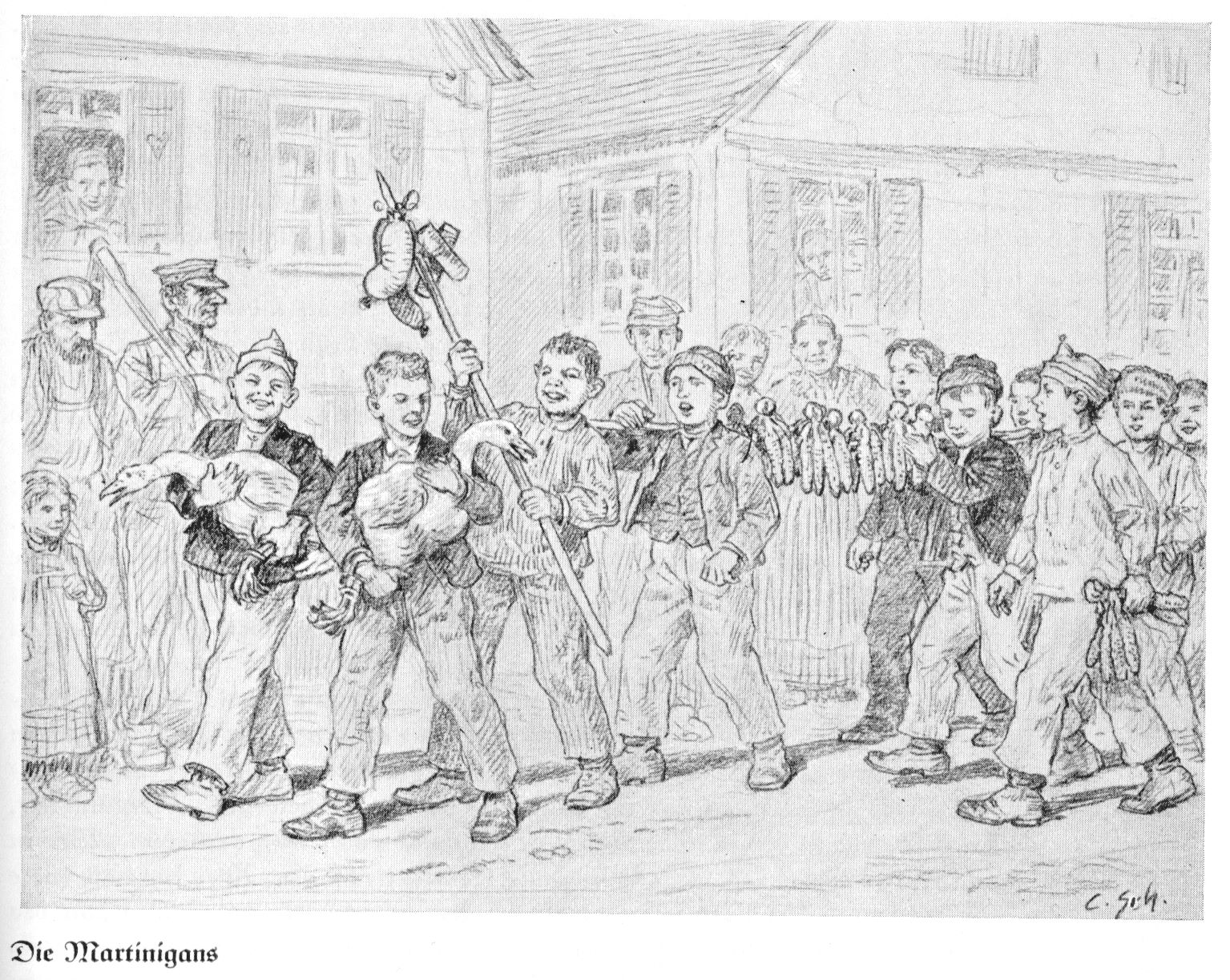
Wenn der erste Saft in die Weidenbüsche einschießt,
gehen die Buben ins "Grün" oder ins "Gschtänd". Dort prüfen
sie mit Kennerblick die einzelnen Büsche. Finden sie eine geeignete
Rute, so wird sie geschnitten und auf die richtige Länge gebracht.
Nun wird die Rinde mit dem Heft des "Hôbemessers" geklopft.
Zweierlei Musikinstrumente kommen auf diese Weise zustand. Entweder
Hupen, die keinen Stöpfel haben und nur einen Ton hervorbringen
- bloß in den Ohren der Jugend klingt er lieblich - oder Pfeifen,
die mit beweglichem Stöpsel versehen Sind, auf denen man deshalb
die Töne variieren und eine kleine Melodie versuchen kann.
Bald wagen sich auch die ersten Veilchen heraus. Im "Grün", im "Wolfelesbach",
im "Gairenwald" findet man die schönsten. Unvergeßlich die
Sonntage, da die weißen Wolkenschiffe sehnsuchterweckend am blauen
Frühlingshimmel dahinzogen, die Finken und Meisen Schlügen,
da jener würzige Ruch der Erde entstieg, der einen so seltsam
benommen machte, und da man ins "Veigelessuche" ging.
Der Märzenmarkt am 25. März, an Mariä Verkündigung,
ist nicht bloß für die Alten wichtig als "Stockmärkt",
an dem manche bis zu 150 Mark Einnahmen hatten, sondern ein großes
Erlebnis auch für die Jungen. Schon an den Vortagen wurden in
der Eßlinger, der Cannstatter, der Langen Straße die großen
kofferartigen, mit Eisenbändern beschlagenen Warenkisten der Schuh-
und Tuchmacher angefahren. Sie als Hindernisse beim Fangerlesspiel
zu verwenden, brachte eine willkommene Abwechslung in dieses beliebtest
und einfachste Spiel. Am meist recht kühlen Marktmorgen war man
Zeuge, wie die Stände aufgeschlagen wurden. Das nötige Baugerät
an Latten, Böcken, Stangen gehörte der Gemeinde und wurde
das Jahr über im Magazin beim Rathaus aufbewahrt. Nun entstand
also vor den Augen der erstaunten Dorfjugend, die an diesem Tag als
einem kirchlichen Feiertag Schulfrei hatte, zu beiden Seiten der Straßen
eine Reihe von Marktständen. Verkäufer und Käufer kannten
Sich meist seit Jahren. Tuchmacher Rommel, Schuhmacher Eisenlohr von
Reutlingen waren Persönlichkeiten, die einfach zum Bild dieses
Marktes gehörten. Es ging also im Handel herüber und hinüber
durchaus gediegen und ruhig zu. Der Jakob aus Amerika, d. h. der Marktschreier,
ist eine Erscheinung, die einer Späteren Zeit vorbehalten blieb.
Damals mochte auch der Markt einem gewissen wirtschaftlichen Bedürfnis
entsprechen. Neben dem Reben- und Baummarkt war von geringerer Bedeutung
der Viehmarkt. An der Runkeleskelter in der Bachstrasse wurden Schweine,
von den Juden "Hirschle" und Lauchheimer auch einige Kühe feilgeboten.
Dort ging es besonders lebhaft und derb zu. Der Stimmaufwand, der entfaltet
wurde, ließ uns Kinder das Schlimmste befürchten. Umso eindrucksvoller
war der Handschlag, der zu guter Letzt die erregten Verhandlungen in
heiteren Frieden ausklingen ließ. Über der Brücke drüben
in der Nähe der uralten Dorflinde war das Karussell aufgebaut;
die Schießbude in einem Hof der Langen Straße rechnete
mit dem Zuspruch der Erwachsenen. Einen fremdartigen Zug in das Marktbild
brachten die Zigeuner, die auf keinem Jahrmarkt fehlten. Schlimme Dinge
wurden ihnen nachgesagt: nicht bloß daß sie stehlen, was
nicht niet= und nagelfest ist, auch Kinder sollten sie entführen.
Deshalb betrachtete die Jugend mit furchtsamer Neugierde die seltsamen
Gestalten, die meist noch einen Bären oder mindestens ein Äffchen
bei sich führten, Auch daß sie wahrsagen konnten, umgab
sie mit einem besonderen Zauber. Freilich die Alten sahen sie lieber
gehen als kommen.
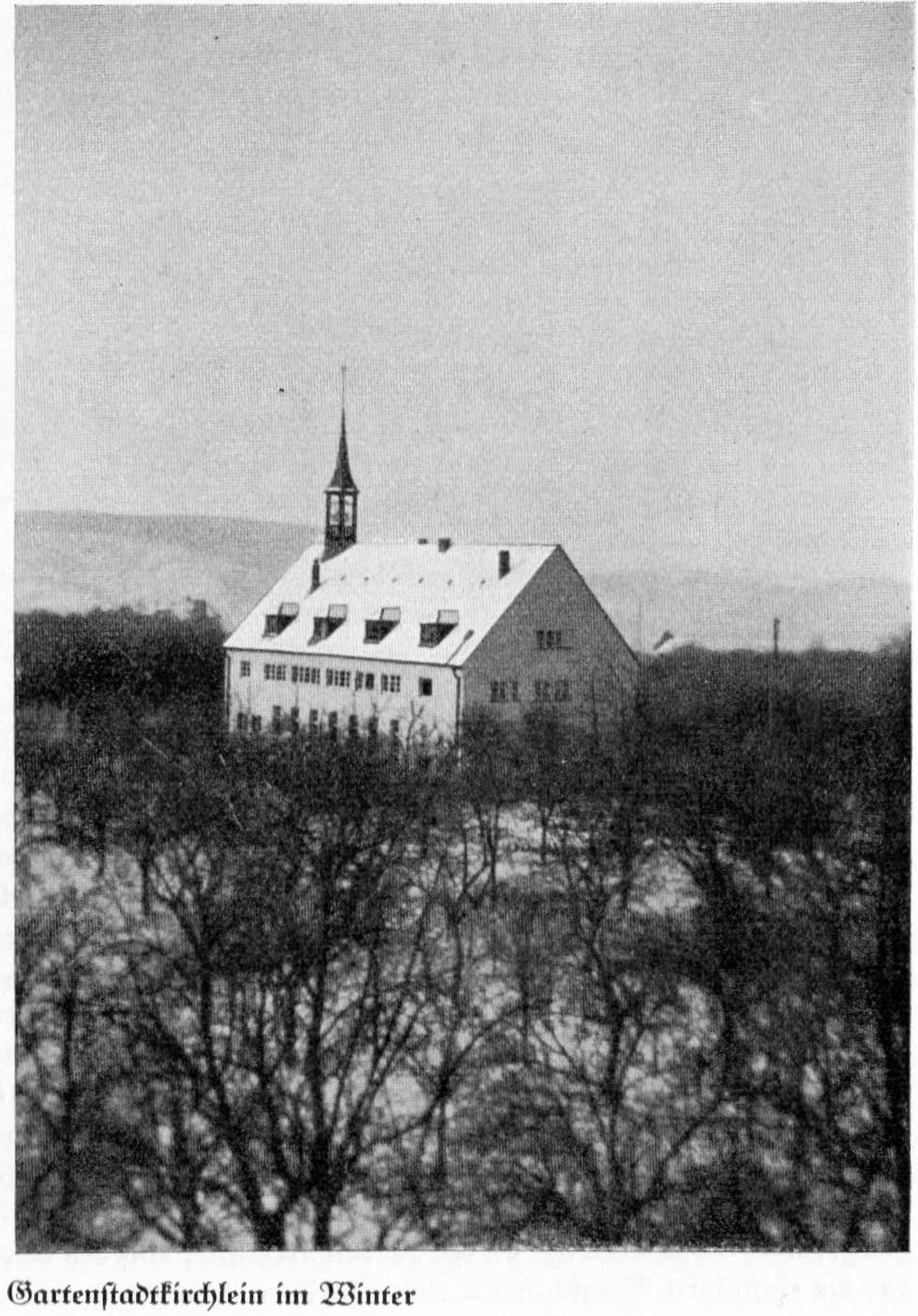
Vom Märzemärkt war es nicht mehr weit bis Ostern. Schon war
auch die Zeit des Ballspielens gekommen. Zur Abwechslung spielten dazwischenhinein
auf ein paar Tage die Buben "Schnelleres", die Mädchen "Perles" und "Bohnerles".
Die Karwoche bildete bei entsprechender Einstellung des Elternhauses
einen starken Einschnitt in der frohbewegten Frühlingszeit. Jedes
laute Spiel, besonders in der zweiten Hälfte der Woche, war streng
verboten. "Wer in der Karwoche Ball spielt, kreuzigt den Heiland",
konnte die Mutter sagen. Aber für diese kurze Entsagung entschädigte
das Osterfest. Schon an den Tagen zuvor hatte man am Hang des Wolfelesbachs
das Moos für das Hasennest geholt. Da man dort so lustig den Hang
herunterrugeln konnte, vergaß man rasch das strenge Gebot der
Eltern. Auch war hier weit weg von den Häusern des Orts kein Kläger,
somit auch kein Richter zu fürchten. Dem Osterfest wurde mit frohen
Erwartungen entgegengesehen. Im Grün oder sonstwo am Neckar war
reiche Gelegenheit, auf Felbenköpfen oder im Weidengebüsch
den "Hasen" zu verstecken. Der Inhalt des Nestes, der "Hasetag", war
bescheiden: einige mit Zwiebelhäuten braun gefärbte Eier,
ein Zuckerhase und eine Brezel, das war alles und doch viel. Denn die
Freude des Suchens und Findens war das Schönste an der Sache,
besonders wenn ein freundlicher Großvater oder eine Großmuter
schmunzelnd dabeistand und mit der Jugend wieder jung wurde.
So kam man allmählich an den Sommer heran. Noch war der Boden
halb feucht und damit die Vorbedingung erfüllt für das interessanteste
Bubenspiel, das "Spechtesspiel". Denn der Ruf durch die Gasse ging: "Wer
duet mit Spechtes?", so fand die Einladung immer ein freudiges Echo.
Mit fünf bis sieben Teilnehmern wurde das Spiel am interessantesten.
Es handelte sich darum, ein kurzes zugespitztes Pfahlstück, das
der Gegner mit kräftig ausholendem Schwung in die Erde getrieben
hatte, durch den eigenen Specht so zu lockern, daß es herausfiel.
War das gelungen, so durfte es beliebig weit hinausgeschlagen werden.
Der Sieger wurde aber in gleicher Weise ein Opfer des Besiegten, wenn
er seinen Specht nicht dreimal in die Erde getrieben hatte, ehe der
Gegner mit dem seinen zurückkam und ihn, schon von weitem werfend,
in den Boden spitzte.
Am Sonntagnachmittag und -abend beherrschten die Mädchen das Feld
bzw. die Straße. Denn einen eigentlichen Dorfanger und Spielplatz,
auf dem sich die ganze Dorfjugend getroffen hätte, gab es nicht.
Das "Gschtänd" wäre ideal gewesen für diesen Zweck,
aber es lag zu weit ab und war als zeitweiliger Aufenthalt lichtscheuen
Gesindels Verrufen und deshalb von den Kindern gemieden. So benutzte
man eben, so gut es ging, die Straße als Spielplatz, und es ging
ganz gut so. Die Reigen der jungen Mädchen, die altvertrauten
Melodien des "O Bue, was koscht dei Heu?", "Mädchen, du mußt
tanzen", "Mariechen saß auf einem Stein" und wie die Tanzspiele
alle heißen gehören mit in das Bild eines sonnigen Sommersonntags
in Untertürkheim.
Spätestens das Betglockläuten oder "Uffamärgaleida" (Ave
= Maria=Läuten), wie die Alten sagten, holte die Kinder von der
Straße weg, wenn sie nicht schon früher heimgerufen worden
waren. In Familien, die auf alte fromme Sitte hielten, wurden die Kinder
angehalten, beim Betglockläuten den Vers zu sprechen: "Liebster
Mensch, was mag's bedeuten, dieses späte Glockenläufen ?
..."
Vom späten Frühjahr ab wurden die Kinder ziemlich stark zur
Feldarbeit herangezogen, deshalb konnte sich ihr Spieltrieb nur noch
Sonntag nachmittags austoben.
Noch einmal, ehe die rauhe Jahreszeit einsetzte und die Kinder von
der Straße vertrieb, feierte das ganze Dorf ein Fest, das große
Fest der Kirbe. Soweit es ein Fest der Erwachsenen war, wird sein an
anderer Stelle gedacht. Auch die Kinder freuten Sich darauf, nicht
bloß wegen der "Märktkromet", die für sie vielleicht
an einem der Stände gekauft wurde, etwa "e Hôbe" oder "e
Bläsle" für die Buben, ein "Nuster" oder ein "Bääle" für
die Mädchen, sondern vor allem wegen der Kuchen, die auf diesen
Tag in verschwenderischer Fülle gebacken wurden. Das ganze Jahr über
gab es fast keine, von besonderen Familienfestlichkeiten abgesehen,
nur der Kirbe waren sie vorbehalten, aber dann gab es auch so viele,
daß man sich für das ganze Jahr satt essen konnte. Es gab
neben den Obst-, Grieß- und Käskuchen, wie sie heute noch üblich
Sind, bescheidenere, die man heute nicht mehr bäckt. Da war der
Salzkuchen, bei dem man einfach den Teig mit Eigelb bestrich, dann
mit Speckwürfeln belegte und mit Salz und Kümmel bestreute,
oder der Welschkornkuchen, bei dem der Teigboden mit einer 2 cm hohen
Schicht Welschkornbrei bestrichen wurde. "Kirbe ond koe Kuecha, essigsaurer
Wei, wer mag dô luschtich sei?", das war ein Vers, den schon
die Kinder kannten, der aber in manchen vergangenen Jahren zu Anfang
und um die Mitte des Jahrhunderts herbe Wirklichkeit geworden war.
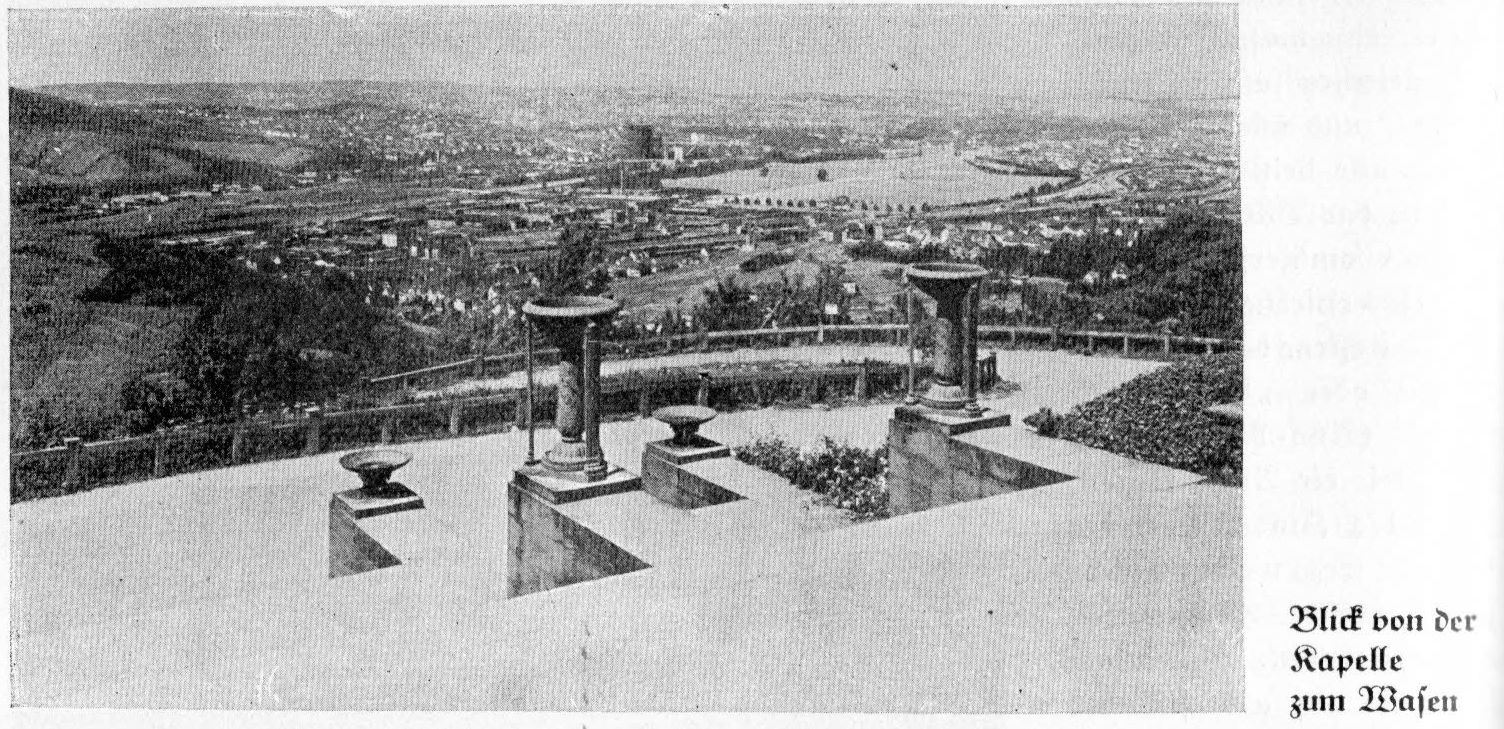
Nach der Kirbe ging es rasch dem Herbst, der Lese,
zu mit ihren Freuden, bei der die Kinder allerdings eine mehr nebensächliche
Rolle spielten. Dagegen standen sie am Martinitag im Mittelpunkt eines
erst in den sechziger fahren aufgekommenen Brauchs. An diesem Tag wurde
nämlich dem Herrn Oberlehrer von den Schülern feierlichst
die "Märesgäs" überreicht. Aus freiwilligen Geldgaben
hatte man die Gans gekauft. Wenn noch Geld übrig war, kamen einige
Zichorienpäckchen, etwas Kaffee, die Spitze eines Zuckerhuts dazu.
Damit der Empfänger der Gans das Tier vollends hermästen
konnte, mußte auch Welschkorn beschafft werden. Da galt nun für
ein paar Tage ein gewisses Freibeuterrecht in Untertürkheim, d.
h. das Welschkorn wurde einfach von den Außenseiten der Häuser
weg, wo es zum Trocknen in "Kluberten" aufgehängt war, gestohlen.
Allerdings konnte es vorkommen, daß die jungen Diebe, wenn sie
nach Hause kamen, an den Stangen vor dem eigenen Elternhaus auch einige
Lücken bemerkten. Das andere konnten sie sich denken. Im feierlichen
Zug wurde alles durch den Ort getragen, einige Lieder dazu gesungen,
und man kam sich für einen Lag sehr wichtig vor.
Nun ging es rasch in den Winter hinein. Brachte er den heißersehnten
Schnee, so fuhr man Schlitten in der Friedrichstraße, im Kirchgäßle
und auf der "Schlittenbahn" im "Usserdorf", ganz Kühne im "Hohlweg" an
der "hohen Mauer". Auf den beiden ersten Bahnen benützte man nur
die einsitzigen Bergschlitten. Am Hohlweg dagegen konnte man auch die "Galetsche" oder "Lanne" bewundern,
große Hörnerschlitten, die gewöhnlich landwirtschaftlichen
Zwecken dienten, nun aber abends und Sonntag nachmittags, mit drei
und mehr Personen beladen, in den Dienst des ländlichen Vergnügens
gestellt wurden. Sie, die mit unheimlicher Geschwindigkeit den Berg
herabsausten, stellten an die Geschicklichkeit ihrer Lenker schon einige
Anforderungen. Schon von weitem hörte man das mehrstimmige "E
Lanne kommt! Bâ frei!" und konnte an dem "Grillen" der Mitfahrerinnen
merken, wenn es wieder über eine der vielen "Kandeln" hinüberging
und der Schlitten ein paar Meter frei durch die Luft sauste. Ein besonderes
Fest für die Jugend war es, wenn eines starken Schneefalls wegen
der Bahnschlitten geschleift werden mußte und sie den Schlitten,
der für den Ortsverkehr die Straßen freizulegen hatte, helfen
beschweren durfte. In den verschneiten Straßen des Orts bewegten
sich besonders leidenschaftliche Schlittenfahrer, auf ihren Schlitten
stehend, durch Stochern mit einem "Spieß", den sie zwischen
die Beine nahmen, vorwärts.
Das Christfest, der "Christtag", nahte. Das Wort "Weihnachten" fand
sich bezeichnenderweise im Sprachschatz von Alt=Untertürkheim
nicht. Auch der Pelzmärte ging nicht um. Andere Vermummungen dagegen
kamen vor. Sie dienten in erster Linie dazu, bei den Kärzen die
jungen Mädchen zuschrecken. Man bediente sich dazu einfachster
Mittel: man verschmierte sich das Gesicht und zog ein Leintuch über
sich. Diese Vermummungen, mehr "Butzen" als Pelzmärte, waren an
keinen bestimmten Tag gebunden. Im allgemeinen sahen die Alten
diese Dinge nicht gern. So war man auch dem Fastnachttreiben
in dem ganz evangelischen Untertürkheim durchaus abhold. "Affegsiechter" wollte
man keine sehen. Der Widerwille dagegen war bei diesem nüchternen
Menschenschlag instinktmäßig stark.
Aus alter Zeit her hatte sich dagegen der Brauch der Knöpflesnächte
noch erhalten. Einige Buben, die sich dazu verabredet hatten, zogen
an den letzten Donnerstagen vor Weihnachten mit Erbsen und Welschkorn
bewaffnet vor die Häuser von Bekannten und warfen eine Handvoll
Körner gegen die erleuchteten Fensterscheiben, um die Insassen
zu Schrecken, beobachteten aber die Wirkung besser von gesichertem
Ort aus, da die Sache von den Alten meist als grober Unfug angesehen
und, wenn die Täter sich erwischen ließen, entsprechend
geahndet wurde.
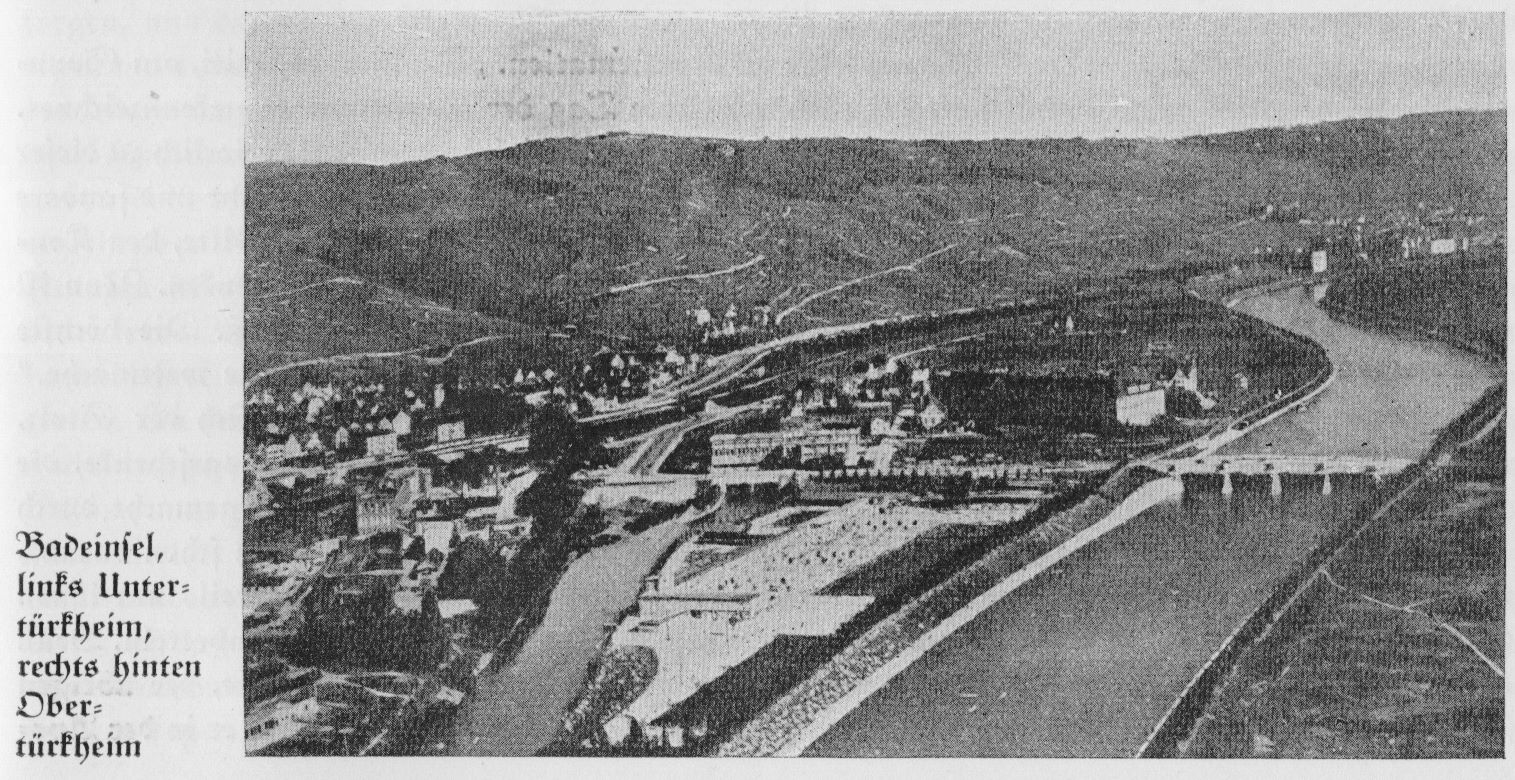
Sonst merkte man vom Nahen des Christtags nicht eben
viel. Bloß daß die Mutter einige Zeit vorher das althergebrachte
Gebäck, die "Springerle" buk, wies auf das kommende Fest hin.
Da es dieses Gebäck nur an Weihnachten gab und bis Ostern keinerlei
Süßgebäck mehr zu erwarten war, freute sich die Jugend
sehr darauf und half beim Backen gerne mit. Besonders der Springerlesmodel
mit feinen merkwürdigen Figuren interessierte sie. Nur verhältnismäßig
wenige Familien besaßen Solche Model, Sie waren ja auch das ganze
Jahr über totes Kapital. Deshalb entlehnte man sie gerne beim
Mehlhändler, der sie dann auch um diese Zeit auf Wochen hinaus
verteilt hatte. Das Schnitzbrot, das man ebenfalls für die Festzeit
buk, unterschied sich vom gewöhnlichen Brot nicht allzusehr, erfreute
sich aber trotzdem nicht überall gleicher Beliebtheit. Beschert
wurde nicht am Heiligen Abend, sondern am Christfestmorgen. Dabei gab
es keine großen Überraschungen. Die Geschenke waren durch
die Sitte vorgeschrieben, aber trotzdem konnten die Kinder kaum erwarten,
bis sie die Stube betreten durften. Noch im Hemd rannten sie herein.
Da brannte in einer Ecke der Stube ein Bäumchen; selbst in begüterten
Familien war es um diese Zeit einfach an der Wand befestigt ohne Gärtchen,
geschweige denn eine Krippe. Es war geschmückt mit vergoldeten
Nüssen, Äpfeln und einigen kleinen Zuckerstücken, die
man beim "Kanditer" erstanden hatte. Glaskugeln verwendete man noch
nicht. Und die Geschenke: Vom Döte erhielt jedes Schulpflichtige
Kind Herkömmlicherweise ein Schreibheft, Griffel, Springerle,
einen Herzlebkuchen mit drei Mandeln. War aber etwa noch ein Apfel
beigelegt, in dem ein Sechs=Kreuzer=Stück steckte, so war die
Freude vollkommen. Die Hauptfache war: die Arbeit ruhte in diesen Tagen,
soweit man sie in einem ländlichen Haushalt eben ruhen lassen
konnte. Am Stephanstag sah man die "Stephesreiter". Die Fuhrleute ritten,
ein sonst ungewohnter Anblick, ihre Pferde aus. Sie sollten vom
langen Stehen im Stall nicht steif werden, Tatsächlich wurde aber
mit diesem Ausritt auch ein alter Brauch weiter gepflegt. Die Arbeitspause
dauerte bis zum vierten Tag, dem Tag, der unschuldigen Kinder oder "Pfeffertag".
Auch an diesem Tag wurde noch nicht viel gearbeitet. Pfeffertag hieß er,
weil die Kinder am Morgen dieses Tages mit einem Tannenwedel, der Pfefferrute,
bei den Bekannten herumzogen und durch einen Schlag mit der Rute und
die Frage: "Schmeckt dr Pfeffer guet?" sich Anspruch erwarben auf ein
kleines Geschenk. Die ursprüngliche Bedeutung dieses Schlags mit
der "Lebensrute" war schon längst verloren gegangen, und so artete
die Sache Schließlich in reine Erpressung aus, die besonders
gegenüber den Kaufleuten des Orts geübt, von vernünftigen
Eltern aber nicht geduldet wurde.
Am "Altjôhrôbed" (die Bezeichnung "Silvester" war in Alt=Untertürkheim
ganz unbekannt) gab es auch ein besonderes Gebäck, das "Mitschele",
an anderen Orten wegen seiner Form Neujahrsschiffchen genannt, das
aber nicht selbst gebacken, sondern beim Bäcker geholt wurde.
Besondere Gebräuche, von dem überall üblichen Neujahrschießen
abgesehen, gab es nicht, kein besonderes Essen und auch keinen Versuch,
gerade an diesem Abend oder in dieser Nacht etwas über die Zukunft
zu erfahren. Das alte Jahr wurde in fast allen Familien mit tiefem
Ernste beschlossen, wie es dem nüchternen Sinn der Alten entsprach,
die des Lebens Not und harten Kampf kannten und auch von der Zukunft
nichts anderes erwarteten.
Für Neujahr schrieb die Sitte den Kindern einen ganz bestimmten
Glückwunsch vor, den sie den Eltern, besonders aber auch dem Döte
und der Dote gegenüber anzubringen hatten. Er lautete: "I weisch
dr a guets nuis Jôôr de gsonde Leib, de Friede, de Seage
ond de heiliche Geischt ond Älles, was dr selber weische magscht!" Auch
für diesen Wunsch bekam man meist eine kleine Belohnung, und wenn's
nur ein kleines Gebäckstück war. Die Reihenfolge der Wünsche
ist bezeichnend für die nüchterne Einschätzung der Lebensgüter
durch die Alten.
Der "Oberste" oder Dreikönigstag (6. Januar) Schloß die
Reihe der Festtage ab. Daß es sich in diesen Wochen um eine Zeit
besonderer Art handelte, konnten die Kinder auch an einem eigenartigen
Brauch merken. Der Vater stellte vielleicht an diesen zwölf "Lostägen" vom
Heiligen Abend bis zum Oberen zwölf Zwiebelschalen auf, die bis
zur Hälfte mit Salz gefüllt waren. Jeder der Tage bedeutete
einen Monat. Nun wurde jeden Morgen Nachschau gehalten. War das Salz
naß geworden, so hatte man entsprechend viel Feuchtigkeit in
dem betreffenden Monat zu erwarten, blieb das Salz trocken, so durfte
man mit Sonnenschein rechnen. Manche Leute, die Sogenannten "Einsteller",
hatten schon am Barbaratag, dem 4. Dezember, frischgeschnittene Reben
ins Wasser gestellt und den Topf am Fenster untergebracht. Je nachdem
die Reben bis in die Festzeit sich entwickelt hatten, entsprechend
lautete die Voraussage für das kommende Weinjahr. Hatten die "Augen" kräftig
ausgetrieben, so war ein guter Ertrag zu erwarten, hatten sie gar im
Wasser Wurzeln gezogen, so gab es einen Vollherbst und Ausstichwein.
Den Schlußpunkt hinter die Kinderzeit setzte die Konfirmation. "Quasimodogeniti,
am Sonntich konfermiert mr mi": damit war der altüberlieferte
Tag der Konfirmation gekennzeichnet. Der Konfirmand schrieb dem Döte
und der Dote einen Patenbrief, in dem er sie feierlich zu dieser heiligen
Handlung einlud. Der Wortlaut lag im allgemeinen fest, und die pünktliche
und saubere Ausfertigung wurde vom Lehrer überwacht. Schon seit
alter Zeit bestand die Sitte, den Konfirmanden im Hinblick auf den
Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt zu beschenken. Nun ist ganz
allgemeiner Grundsatz bei den Alten, daß alles wettgemacht werden
muß. Die höchste Anerkennung für ein Geschenk bedeutet
der Ausspruch: "Des kâ i jô gar nemme wettmache." Wer etwas
auf sich hält, will niemand etwas schuldig sein. Dahinter verbirgt
sich der Stolz, aber auch ein gut Stück Lebensklugheit. Und so
wurden alle diese Konfirmationsgeschenke, die zumeist in einem Geldstück,
einem Taschentuch, Halstüchle usw. bestanden, wettgemacht durch
Backwerk, das der Konfirmand austragen mußte. Die jüngeren
Kinder warteten schon darauf, daß die Konfirmanden mit ihrem "Grättle" auf
der Straße Sich zeigten, einesteils um ihnen spottend nachzurufen: "Konfermand
hôt koen Verschtand", andererseits um sie anzubetteln. Denn der
Konfirmand hatte die Pflicht, von den reichen Gaben, die er bekommen
hatte, der übrigen Dorfjugend auch etwas mitzuteilen. Er entledigte
sich dieser Verpflichtung, indem er in der Apotheke oder beim "Kanditer" Sich
um einige Kreuzer "e Gikle Pfeffermenzkiechle" erstand. Die teilte
er nun, nachdem er sich selbst einen erheblichen Prozentsatz einverleibt
hatte, auf der Straße aus. Aber beileibe nicht so, daß er
etwa seinen jüngeren Kameraden davon in die Hand gedrückt
hätte, sondern wenn er einen genügenden Kometenschweif von
Kindern hinter sich hatte, warf er seine Schätze hoch im Bogen über
die Köpfe weg, so daß eine große Balgerei entstand.
Auf diese Weise hatte er auch etwas für sein Geld, und es entstand
so etwas wie ein Volksvergnügen, das durchaus harmloser Art war.
Beim Fest selbst trat der Konfirmand auch äußerlich als
Erwachsener auf. Ein Zylinder und ein regelrechter, meist mehr für
die Zukunft als für die Gegenwart berechneter Kirchenrock gaben
ihm ein Aussehen, das nur dadurch erträglich wurde, weil die Sitte
es eben so verlangte. Der Einfluß der Stadt machte diese Tracht
bald unmöglich. Aber es hat in der Übergangszeit in einzelnen
Familien noch harte Kämpfe gekostet, bis sie abgeschafft war.
Denn auch in diesen Dingen hielt man in manchen Kreisen, und nicht
in den schlechtesten, streng am Hergebrachten fest. Und eben in diesen
Familien hielt man auch streng darauf, daß der Ernst des Tags
durch keine Ausgelassenheit gestört wurde, weder auf seiten der
Alten noch auf denen der jungen, die sich ja zum erstenmal in den Mittelpunkt
einer Familienfeier gestellt sahen. Besonders feierlich wurde auch
der Tag des ersten Abendmahls begangen, bei dem die Sitte verlangte,
daß, wenn irgend möglich, auch die Paten sich beteiligten.
Nun lagen die Kinderjahre hinter dem Konfirmanden, er tritt in die
geregelte Berufsarbeit ein. Trotzdem betritt er nach Verlassen der
Schule in den allermeisten Fällen kein eigentliches Neuland: der
Knabe und das Mädchen aus den Weingärtnersfamilien bleiben
in dem Lebenskreis, der sie schon bisher umhegt hat. Daraus erklärt
sich auch das Festhalten am Althergebrachten, das wir bei den "Eingesessenen" so
oft antreffen. Überlieferung gedeiht eben am besten als Familienüberlieferung.